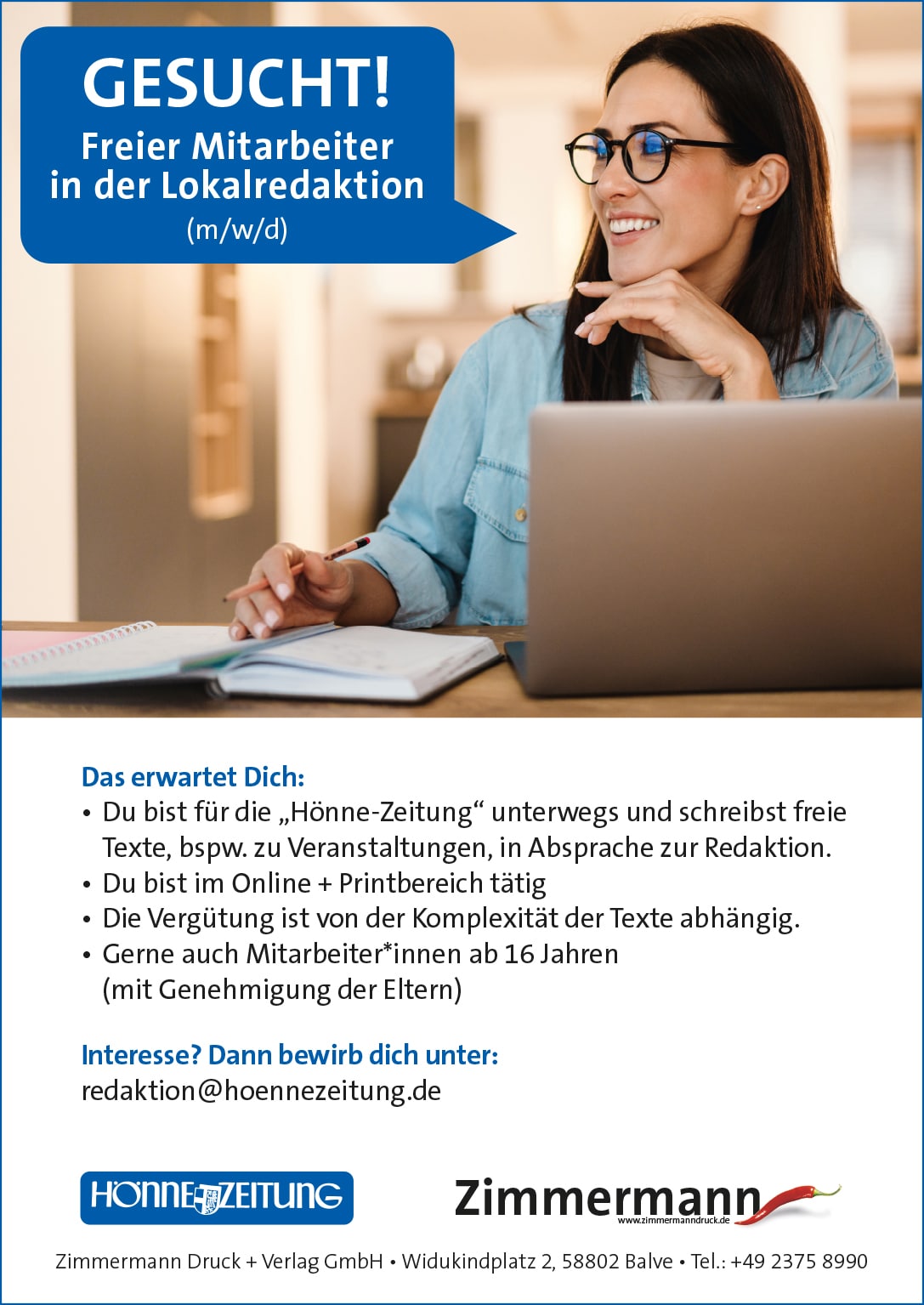Balve. Burkhard Wendel gehört in Balve zur Gruppe der Ahnenforscher, die sich mehrmals im Jahr treffen. Er gehört zu den erfahrenen Leuten des Arbeitskreises, hat selbst seinen Stammbaum verfolgt und hilft anderen, wo er nur kann. Dabei erreichen ihn auch Anfragen aus dem Ausland, um die er sich gerne kümmert. Die HÖNNE-ZEITUNG wollte mehr zum Thema Ahnenforschung wissen.
Herr Wendel, „Arbeitskreis Ahnenforschung“, was muss ich mir darunter vorstellen?
Wir sind ein lockerer Kreis von etwa dreißig familiengeschichtlich interessierten Personen aus Balve und Umgebung. Der Arbeitskreis ist kein Verein, daher gibt es keine entsprechenden Strukturen mit Vorstand oder Mitgliedsbeiträgen. Neben mir ist Adalbert Allhoff-Cramer Ansprechpartner für Interessierte. Er ist per Mail unter ad.ac@posteo.de zu erreichen. Meine Mail-Adresse für Anfragen lautet burkhard-wendel@t-online.de.
Der Arbeitskreis ist unter dem Dach des NHV – Naturhistorischer Verein Hönnetal – organisiert. Zu den Treffen, die aktuell dreimal pro Jahr im Lohgerberhaus in der Alten Gerichtsstraße 10 in Balve bei Adalbert Allhof-Cramer stattfinden, kommen die „alten Hasen“, die sich zum Teil seit Jahrzehnten mit der Erforschung ihrer Familie beschäftigen, um sich auszutauschen. Regelmäßig kommen aber auch „Frischlinge“ zu unseren Treffen, die Familienforscher*innen werden möchten und sich erkundigen, wie man wo beginnt und sich bei uns Tipps und Hilfe holen. Manchmal können wir auch direkt mit Ergänzungen zu den Stammbäumen der Besucher weiterhelfen.
Was motiviert Menschen dazu, auf die Suche nach ihren Wurzeln zu gehen?
Das Interesse an der Familienforschung kommt in der Regel erst im etwas fortgeschrittenen Alter, insbesondere, wenn eigene Kinder bzw. Enkelkinder vorhanden sind. Ich selbst beschäftige mich aber etwa seit meinem 15. Lebensjahr mit der Genealogie (Familienforschung). Immer mehr Menschen beschäftigt irgendwann in ihrem Leben die Frage nach ihrer Herkunft bzw. nach ihren familiären Wurzeln. In welchen Orten lebten meine Vorfahren unter welchen Bedingungen? Welchen Berufen gingen sie nach? Wie verlief ihr Leben im Kontext zu jeweiligen Zeitgeschichte? Familienforschung ist eben nicht nur das Aneinanderreihen von Vor- und Zunamen und Geburts- bzw. Taufdaten, Heiratsdaten und Sterbe- bzw. Beerdigungsdaten. Schnell ist man von der Familien- auch bei der Heimatgeschichte.
Erst dann, wenn man nach Möglichkeit etwas mehr über das Leben der Vorfahren herausfinden kann, sind es keine abstrakten Personen mehr, sondern wichtige Glieder in einer Kette, ohne die es einen selbst heute nicht geben würde. Fehlt nur ein Glied in dieser unendlich langen Kette, würde es einen selbst, so wir sind, nicht geben.
Wie unterstützen Sie sie dabei?
Die erfahrenen Familienforscher unseres offenen Arbeitskreises geben Tipps und Ratschläge zur Selbsthilfe, aber auch, wenn möglich, direkte Ergänzungen zu den Stammbäumen der Besucher. Das geschieht uneigennützig und unentgeltlich.
Welche Quellen dienen Ihnen?
Da sind zunächst unsere eigenen Forschungsergebnisse. Darüber hinaus sind die Quellen vielseitig. Es gibt zahlreiche Bücher, die sich mit der Familienforschung allgemein beschäftigen, aber auch viele Veröffentlichungen von Forschern, in denen diese ihre Ergebnisse und Stammreihen publiziert haben. Auch die recht umfangreiche heimatgeschichtliche Literatur ist eine wichtige Quelle für Familienforscher. Unverzichtbar sind die Kirchenbücher (z.B. gehen die Balver Kirchenbücher bis 1648 zurück) bzw. standesamtlichen Unterlagen (in Preußen, so auch in Balve, werden standesamtliche Register seit 1874 geführt). Im Rahmen der gesetzlichen Schutzfristen (Datenschutz) sind die Geburtsregister der letzten 110 Jahre, die Heiratsregister der letzten 80 Jahre und die Sterberegister der letzten 30 Jahre nicht einsehbar.
Bis zum Ablauf dieser Fristen sind Auskünfte in der Regel nur den betroffenen Personen, ihren Angehörigen (z.B. Vorfahren) gestattet. Die älteren Kirchenbücher vieler Kirchen, z.B. der hiesigen katholischen Kirchen Balve, Affeln und Menden, sind übrigens digitalisiert und online Seite für Seite kostenlos auf der Plattform Matricula einsehbar. Für die evangelischen Kirchenbücher gibt es mit Archion auch eine Plattform im Internet, Archion ist allerdings nicht kostenlos.
Zudem gibt es verschiedene nützliche und informative genealogische Seiten im Internet, z.B. Familysearch (kostenlos), Ancestry und Myheritage (beide gebührenpflichtig).
Wer war der älteste Nachfahre, den Sie bisher nachweisen konnten?
Kann ich jetzt nicht so sagen. Meine mütterlichen Vorfahren kommen klar überwiegend aus dem kurkölnischen Sauerland, insbesondere aus den Kirchspielen Balve und Affeln. In den meisten Fällen kann ich die Familien meiner Vorfahren bis zum Beginn der jeweiligen Kirchenbücher zurückverfolgen, das heißt, bis in das 17. Jahrhundert, bei einigen wenigen adeligen Familien auch darüber hinaus.
Das sogenannte „Kleine Welt Phänomen“ besagt, dass jeder Mensch mit jedem anderen über sechs Ecken verbunden ist? Wie oft stellen Sie bei Ihren Nachforschungen Verbindungen zwischen scheinbar getrennten Familienstammbäumen oder gar bekannten Persönlichkeiten fest?
Mit den hiesigen alteingesessenen Familien, die seit Jahrhunderten hier ansässig sind, bin ich wohl oft „über sieben Ecken“, mit allen verwandt. Das liegt daran, dass bis in das 19. Jahrhundert, ja, sogar bis in das 20. Jahrhundert, fast ausschließlich nur „rund um den Kirchturm“ geheiratet wurde. Die Ehepartner kamen immer wieder entweder aus dem eigenen Dorf oder zumindest aus dem eigenen Kirchspiel, in diesem Fall Balve. Verbindungen zu scheinbar getrennten Familienstammbäumen aus der Umgebung sind sehr häufig festzustellen. Bekannte Persönlichkeiten, auch über Seitenlinien, konnte ich bisher bei meinen Vorfahren nicht belegen.
Wie hat sich Ahnenforschung durch die Digitalisierung verändert?
Die Digitalisierung und die damit verbundenen Recherchemöglichkeiten im Internet haben die Familienforschung enorm erleichtert und täglich werden neue relevante Daten ins Netz gestellt. In früheren Zeiten konnten Kirchenbücher und andere Quellen in staatlichen, kirchlichen und privaten Archiven nur vor Ort eingesehen werden, verbunden oft mit recht aufwendigen Anreisen.
Natürlich ist auch heute noch manchmal Archivarbeit vor Ort angesagt, da sehr viele Quellen (noch) nicht digitalisiert sind. Durch die Digitalisierung hat die Familienforschung auf jeden Fall einen gewaltigen Schub erhalten, da das Internet bequem zu jeder Tages- und Nachtzeit sogar im Schlafanzug oder Bademantel durchforstet werden kann.
Welche historischen Ereignisse führen nach Ihrer Erfahrung zum Abriss oder zur Verzweigung von Familienlinien?
Seit frühester Zeit bis heute führen Kriege und Vertreibungen zur Trennung von Familien. In Deutschland hat es extreme Bevölkerungsverschiebungen insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1945 durch Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten gegeben. Sehr viele der Betroffenen fanden eine neue Heimat in West- und Mitteldeutschland. Viele Familien fanden nie mehr oder erst nach Jahrzehnten wieder zueinander.
In der heutigen schnelllebigen und anonymen Zeit stelle ich leider zunehmend fest, dass der Familienzusammenhalt bei vielen bröckelt und der Kontakt zwischen Eltern und Kindern bzw. unter Geschwistern aus meiner Sicht gedankenlos oder wegen Nichtigkeiten eingestellt wird. Daher freue ich mich immer wieder darüber, wenn auch noch Familie wirklich „gelebt“ wird.
Im Internet werden Gentests angeboten, die einem seine Herkunft verraten. Was halten Sie davon?
Genealogische DNA-Tests sind heute ein wichtiges und spannendes Hilfsmittel bei der Familienforschung. Solche Tests geben Aufschluss über die eigene ethnische Abstammung und helfen, Übereinstimmungen mit unbekannten Forschern und Forscherinnen zu finden. Bei recht hoher Übereinstimmung der genealogischen DNA und einer Kontaktaufnahme untereinander besteht die Möglichkeit sich auszutauschen und zu ergänzen.
Es gibt verschiedene Anbieter im Internet, z.B. Ancestry und Myheritage. Ich selbst habe bei diesen Anbietern Tests machen lassen und habe dadurch neue Erkenntnisse gewonnen. Die Erwartungshaltung hinsichtlich Erfolgen sollte aber nicht zu groß sein. Man muss sich aber darüber bewusst sein, es geht bei DNA-Tests um sehr sensible Daten.
Sind Sie im Rahmen Ihrer Forschungen auch auf Namensänderungen gestoßen, wenn z. B. aus einem Smid ein Schmidt wird?
Selbstverständlich. Eine feste Namensschreibung bei uns gibt es erst seit der Einführung der Standesämter 1874. Je weiter man zurückgeht bei den Forschungen in Kirchenbüchern oder sonstigen Quellen herrscht oft ein regelrechtes Durcheinander bei der Namensschreibung. Der Hofname stand z.B. über dem persönlichen Familiennamen. Viele Personen werden bei Kirchenbucheinträgen bei der Taufe anders genannt wie bei der Heirat. Und beim Todeseintrag heißen sie dann nochmal anders.
Außerdem muss man bedenken, der Pastor, der das Kirchenbuch führte, kam oft gar nicht gebürtig aus seinem Kirchspiel und kannte daher die Familien zumindest anfangs gar nicht. Zudem schrieb der Pastor den Familiennamen nach seinem Gehör. Familiennamen waren in früheren Jahrhunderten wandelbar und nicht feststehend.
Vielen Dank Herr Wendel für die Ausführungen zum interessanten Thema der Ahnenforschung.
Das Interview führte Daniel Pütz per E-Mail.